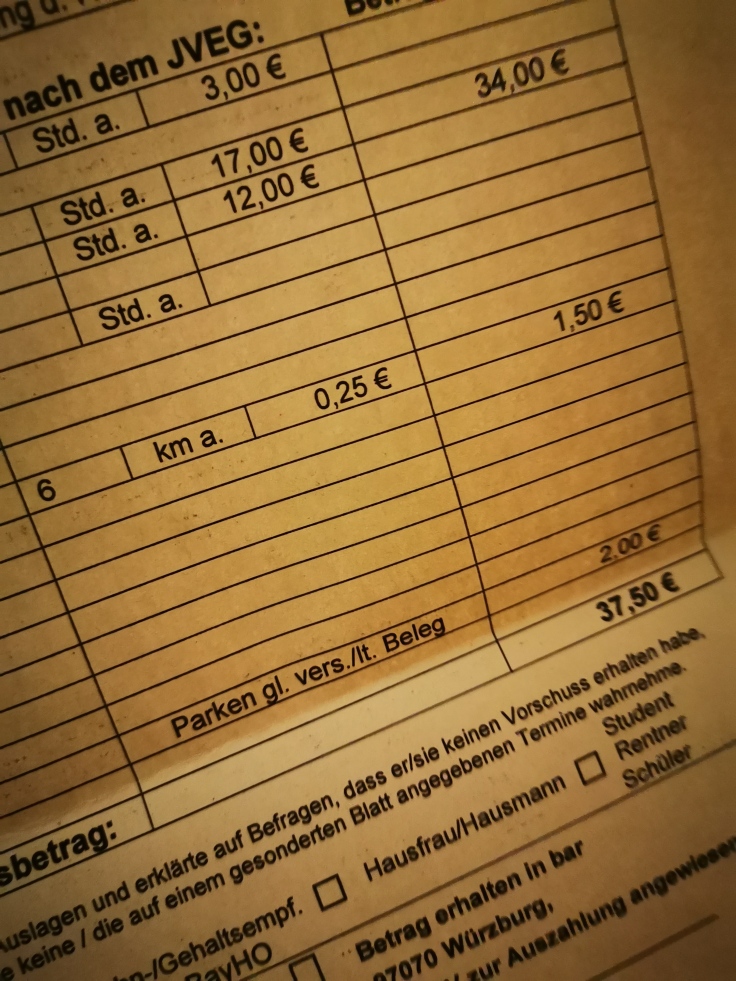Ich lese in schlaflosen Nächten das Internet leer.*
Ich lese von Hass und Rassismus. Von Faschisten und wie Leute abknallt und erschossen werden. Ich lese von „Auswahl“ und „Umvolken“, von alten weißen Männern, die alles besser wissen und von Feministinnen, die nur mal wieder so richtig durchgevögeln werden müsste. Ich lese von Kinderarmut und Homophobie. Ich lese von Mobbing auf Twitter und von einem kleinen Mädchen, mit dem der syrische Vater ein lustigen Spiel erfunden hat: lachen, wenn die Bomben fallen, damit die Angst keinen Raum bekommt. Ich lese von Anfeindungen, weil die Evangelische Kirche ein Schiff gekauft hat und auf Rettungsmission schickt. Ich lese und lese bis mir der Zorn hochkommt oder die Tränen aufsteigen.
Wut und Tränen bringt einen natürlich nicht weiter. Die Welt wird nicht durch Gedanken und Gebete zu einem besseren Ort werden. Auch nicht, wenn ich ein hübsches, gut designtes Meme davon in allen Netzwerken poste.
Die Welt könnte aber möglicherweise zu einem besseren Ort werden, wenn wir mehr andere Geschichten lesen würden. Von Unterstürzung und Hilfe. Von Liebe und Freundschaft. Vom Aufblühen und Verschwenden. Von Hege und Pflege.
Und weil man ja irgendwo mal anfangen muss, beginne ich, genau so eine Geschichte zu erzählen #makelovegreatagain
Ich war im 2. oder 3. Ausbildungsjahr zur Krankenschwester. (Jaja- ich bin so alt: ich bin noch eine Krankenschwester.) Seit ein paar Wochen war ich auf „der Inneren“ und es war die Hölle. Strenge und klare Hierarchie, Funktionspflege, Schülerdasein mit Waschstraße und Anschiss, weil nie schnell genug. Rüffel, weil die Ecken der Kissen, die man frisch bezogen hatte, nicht anständig herausgezogen waren. Damals war es üblich, an einem Tag in der Woche alle 34 Betten frisch zu beziehen. Möglich, dass bei Bett 27. ein wenig die Luft raus war. Man durfte keinesfalls trödeln. Denn die nächste Runde „Patienten betten“ stand an – was bedeutete, dass man die Schwerkranken und bettlägrigen Patienten neu lagerte. In fast jedem Zimmer lag mindeste einer dieser schwer pflegebedürftigen Menschen. Wir SchülerInnen rannten uns die Hacken ab, die Vollschwestern schrieben derweil Kurven und kochten sich einen Kaffee. Na gut – bestimmt half die ein oder andere auch mal mit. Aber das „Pflegen an sich“ wurde meistens uns Auszubildenden überlassen. Nie Zeit, immer Druck, wenig Anerkennung und Freude. Dieser Ausbildungsabschnitt war in meiner Erinnerung die Vorstufe zur Hölle. Jeden Tag schlich ich nach der Schicht in den 1. Stock des Schwesternwohnheims und fiel meistens sofort ins Bett. Aus. Ende Gelände. Fertig und körperlich extrem erschöpft. Meine Mitauszubildenden nickten milde und wissend, wenn ich nicht mehr sprechen wollte, einen Besuch in der Disco ablehnte oder mich an meine Freundin lehnte und seufzte. Menschen helfen – dafür waren wir. Ich hoffte sehr, dass ich das tat. Und vor allem hoffte ich, das diese Zeit schnell vergehen möge. Oder aber alle Schwerkranken endlich gesund oder verlegt werden würden. Gerne rasch, bevor ich noch mehr körperlich und geistig zerrüttete.
Mein damaliger Freund war mäßig begeistert von den Zuständen, in denen er mich in dieser Zeit vorfand. Das war mal anders geplant. Mehr so Vergnügen und Entertainment. Spaß und Unternehmungen, lange Spaziergänge und leise Gespräche, Liebe, Flausch und Sex. All das, was eine Liebe so ausmacht, bekam er in dieser Zeit nicht, weil ich einfach nur erschöpft und fertig war.
Ich erinnere mich, wie ich das Zimmer betrat und er schon da war.
Wie ich mich freute, ihn zu sehen.
Wie ich in Tränen ausbrach, weil alle Erschöpfung, alle Überforderung, alle körperlichen Schmerzen nach einer Knochenschicht hier Raum finden durften.
Wie ich neben ihm saß und leise weinte und er mich im Arm hielt und nicht sprach. Kein “Das wird schon wieder“ und auch kein “Ach komm schon“ und auch kein „Kopf hoch, das geht vorbei“.
Ich erinnere mich, wie wir lange so da saßen und er schließlich aufstand und meine für Schmutzwäsche umfunktionierte alte Waschschüssel mit den alten Pullis und Schlüppies auskippte.
Ich erinnere mich, wie ich zusah und nicht wusste, was er wollte und es aber egal war.
Ich erinnere mich, wie er Wasser in die Schüssel einließ, wie er zum Waschlappen und zur Seife griff und alles zu mir brachte. Wie er mich sanft auszog und wusch.** Wortlos. Wie er mich abtrocknete und mir frische Sachen überstreifte. Wie er mir eine Zigarette anzündete und wir schweigend rauchten. Wie wir dann im Bett lagen. Ich spürte seine Hand, sanft streichelnd auf meinem Haar.
Ich erinnere mich, wie ich einschlief. Zur Ruhe gekommen. Unendlich geliebt.
Das, werte Freunde ist es, was ich euch erzählen wollte. Einen innigen Moment wahrer Liebe. Ein heilender und heiliger Augenblick.
Dazu muss man natürlich keinen waschen. Man muss noch nicht mal eine rauchen. Es ist egal, was man dem anderen angedeihen lässt.
Es ist die Bereitschaft, von allem, was man vielleicht gerade selber wollte, zurücktreten. Zu sehen, was ist und es dann dem anderen geben zu wollen. Ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Dieses Erlebnis ist unendlich viele Jahre her und tief in meiner Seele verankert.
Wir alle brauchen solche Seelenverankerungen von Liebe und Trost. Von einfachem Dasein und MitdurcheineSituationgehen. Vom Begleitet- und Gehalten werden. Manchmal reichen kleine Gesten aus, die die Welt zu einem besseren Ort machen können.
Es wird – glaubt man den nächtlichen Artikeln aus dem Netz – mehr Menschen geben, die leider keine solche Erinnerungen haben, als diejenigen, die auf solche Herzensschätze zurückgreifen können.
Wir jedoch, die sie haben, müssen sie unbedingt in die Welt weitertragen. Damit Hass nie siegt.

*weil „das Internet“ dafür bekannt ist, gerne ungefragt Ratschläge erteilen zu wollen: Ich werde auch weiterhin nachts das Internet leer lesen. Auch wenn 87 Studien bewiesen haben, dass man nachts nicht auf sein Handy schauen soll – ja: es wäre besser, es weit weg zu legen. Am besten wäre es, man würde es im Garten vergraben. Somit – weil ich es nicht tue – wäre es ja dann auch kein Wunder, wenn ich nicht in den Schlaf finde. Richtiger Schlaf kommt, wenn man sich richtig verhält. Handy also in den Garten, Raumtemperatur an der Fröstelgrenze, harte Matratze, die Decke bitte nicht von armen Daunenfedernentenliferanten, denen der Flaum bei lebendigen Leibe ausgerupft wurden. Lavendelsäckchen unter dem Memory Foam Kissen.
Ihr müsst mir das nicht sagen. Spart euch den Ratschlag. Geht stattdessen lieber in Welt und küsst jemanden. Sagt euren Liebsten, wie sehr ihr sie schätzt und mögt. Sät eine Blume. Ihr wisst ja: Wer anderen einen Blume sät, blüht selber auf!
**Es zahlt sich durch aus, wenn eure Liebsten – so ihr denn in eine Ausbildung seid – mit euch den Lehrstoff lernt und abfragt. Küsschen gehen raus an all diejenigen, die das tun.